#language matters
Schwerpunktthema Kirchenjahr 2024/25
Hinweis: Das jährliche Schwerpunktthema bietet zusätzliche Hintergrundinformationen zum Zusammenhang »Kirche, Christsein und Nachhaltigkeit«. Die Predigtimpulse im jeweiligen Kirchenjahr greifen es vereinzelt auf, sind aber nicht an das Schwerpunktthema gebunden.

Kriege, Klimaangst, Angriffe auf Freiheit, Menschenwürde und Menschenrechte: Die Zuversicht, etwas ändern zu können, schwindet zunehmend, Viele fühlen sich ohnmächtig – obwohl gerade der christliche Glaube eine Rolle der Mitgestaltung und Heilung nahelegt und auch Stärkung verspricht! Warum kommt dieses christliche »empowerment« im Alltag global so wenig zur Geltung? Welche Bedeutung hat dabei die Sprache?
Es kann, oder besser sollte nicht sein, dass »konkurrierende Sprachmuster« in einer christlich geprägten Welt auf einmal Bedenken, Lähmung oder Angst transportieren, statt Hoffnung zu machen!
Das Schwerpunktthema »Gestalten – mit Sprache« soll solche Muster in den Blick nehmen, sie entschlüsseln und Alternativen aufzeigen, die sich aus der Erfahrung aus der praktischen Entwicklungs- und Umweltarbeit ergeben. Welche Ansätze bietet die Bibel, um eine Sprache der Hoffnung und Mitgestaltung (wieder) in den Vordergrund zu stellen? Das betrifft Klimawandel und Kriege – aber auch andere Bereiche, in denen soziale Ungerechtigkeit auf Ohnmacht, Angst und Lähmung stößt.

Die Ökumenische Friedensdekade ist ein mächtiges Instrument der Kirchen. Es gilt, sich angesichts der Kriegsschauplätze in Europa und im Nahen Osten dessen bewusst zu werden. Jesus begrüßt die Jünger und letztlich uns mit den Worten: »Der Friede sei mit euch.« Lasst uns darüber sprechen!
Biblischer Einstieg: »... geh hin und sündige hinfort nicht mehr« (Joh 8,11)
Die bekannten Verse, denen das Zitat entnommen ist, sind mit »Jesus und die Ehebrecherin« überschrieben. Worin besteht der Bezug zum diesjährigen Schwerpunkthema, und warum verdient die Bibelstelle, hier als Einstieg vorangestellt zu werden? Normalerweise wäre die Frau (»nach dem Gesetz Mose«) gesteinigt worden. Jesus richtet aber nicht und klagt nicht an, obwohl die Schriftgelehrten und die Pharisäer das in diesem Moment von ihm erwarten. Er findet Worte, um den Raum für das Neue, Ungewohnte zu öffnen (ohne das Gesetz Mose zu brechen): »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« Und danach: »... geh hin und sündige hinfort nicht mehr.«
Der Gedanke, Räume mithilfe von (neuer, christlicher) Sprache zu öffnen, öffnet auch den Raum zu den folgenden Beiträgen. Sprache stiftet Beziehungen, wenn man sie wie Jesus gebraucht.
Hinschauen - und darüb
Dr. Gerd Müller, in den Jahren 2013 bis 2021 in Deutscher Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat 2021 in seinem Grußwort an »nachhaltig predigen« eindringlich darauf hingewiesen, dass wir nicht wegschauen dürfen, wenn in anderen Ländern der Welt Menschen und Natur ausgebeutet werden. Hinschauen ist ein wichtiger Baustein, um ins Reden und Gestalten zu kommen. Das Ergebnis war das deutsche Lieferkettengesetz, ebenfalls im Jahr 2021.
Das europäische Lieferkettengesetz ist in der Schwebe. Anfang April 2025 strebt das EU-Parlament einen Aufschub an: Wettbewerbsnachteile werden befürchtet (s. www.tagesschau.de/ausland/europa/lieferkettengesetz-eu-parlament-102.html). Sprechen wir über Sinn und Zweck fairen Wirtschaftens.

In der (kirchlichen) Entwicklungsarbeit, aber nicht nur dort, stellt sich die Frage nach fairem Umgang auf Augenhöhe. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen von »Entwicklung«. Manches muss sich dem Vorwurf eines Neokolonialismus stellen, in dem die Helfenden bestimmen, welche Entwicklung für die Länder etwa des Globalen Südens »richtig« ist. Entwicklungshilfe auf Augenhöhe setzt jedoch zunächst den Aufbau einer echten »Du«-Beziehung voraus (s. Projekt »Keine Energie auf Kosten der Ärmsten!« von Misereor als anschauliches Beispiel).
Stephan Grätzel erforschte als Professor für Praktische Philosophie die Rolle der Sprache bei der Entstehung und der Erhaltung fairer und gelingender Beziehungen. Dem Phänomen der »Dialogik« kommt eine Schlüsselrolle zu, will man Sprache in ihrer Beziehung stiftenden Funktion zur Geltung bringen.
» zum Beitrag »Sprache stiftet Beziehungen«
Dr. Stephan Grätzel, 1998-2018 Universitätsprofessor für Philosophie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, leitete den Arbeitsbereich Praktische Philosophie sowie die internationalen Forschungsstellen zu Maurice Blondel und Eugen Fink. Seine Arbeiten zum Thema Sprache flossen u. a. in Versöhnung: die Macht der Sprache (Freiburg 2018) und Verstummen der Natur (Würzburg 1997) ein.

Sprache kann lähmen, Ohnmachtsgefühle auslösen, das, was wir angesichts aktueller ökologischer und sozialer Herausforderungen, die zum Handeln drängen, gerade nicht brauchen. Dabei ist Sprache bei genauem Hinsehen ein wesentlicher Lösungsansatz. Zum einen, dass über Probleme gesprochen wird, zum anderen aber auch, wie über sie gesprochen wird: Die Schuld hin und her zu schieben hilft nicht weiter, sondern ins (Neu-)Gestalten und Handeln zu kommen. Neue Wege finden »zu können« statt verzichten »zu müssen«.
Maria Clara Kissel arbeitet bei Pax Christi in der Friedensforschung, hat Religionswissenschaften und Soziologie studiert und und befasst sich schon länger mit der Frage, wie sich Religion und deren Inhalte sprachlich vermitteln und wie sie (auch bei ihrer beruflichen Tätigkeit) wirklich wirksam werden können.
» zum Beitrag »Schuld, Ohnmacht und Klimaerwärmung: Warum unsere Sprache ein Problem ist und wie sie Teil der Lösung werden kann«
»Friede sei mit dir – und zeige sich in deiner inneren Haltung, deiner Gestaltungskraft und in deiner Gestaltungsbereitschaft!«

Sprache? Darüber sprechen: »Reli fürs Klima«
»Reli fürs Klima« hat einen Wettbewerb »Planet im Gerichtssaal – Sollte die Natur Rechte haben?« ausgerufen. SchülerInnen haben sich mit den Rechten der Natur auseinandergesetzt und tolle Ideen entwickelt (s. Aufruf: www.diakonie-portal.de/diadwbo-uploads/user_upload/Themen/Diakonie_weltweit/Brot_fuer_die_Welt/66._Aktion/Wettbewerb-Reli-fuers-Klima-2025.pdf). Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt von Brot für die Welt und der Ev. Kirche Berlin - Brandenburg - schlesische Oberlausitz. Die Ergebnisse werden Anfang Juli veröffentlicht.
 Mit Sprache zur Mitsprache: Gleichwürdige Beziehungen ...
Mit Sprache zur Mitsprache: Gleichwürdige Beziehungen ...
»Gleichwürdige Beziehungen in der Entwicklungszusammenarbeit leben – voneinander lernen, miteinander ›weiser werden‹, gemeinsam an der Zukunft weben« war der Titel eines Vortrags von Heike Teufel (KEB Rottweil) bei der Tagung »Dogma und Pastoral in der Beziehungskrise« im Februar 2025 an der Kath. Akademie in Hohenheim. Es wurden verschiedene kirchliche Arbeitsfelder in den Blick gerückt, bei denen kirchliche Praxis und theologische Theorie in ein Spannungsfeld geraten können. Eines davon ist die Entwicklungszusammenarbeit, bei der postkoloniale Perspektiven und Dekolonialisierung in einen weitreichenden Entwicklungsprozess getreten sind. Bei der Gestaltung des Prozesses spielt die sprachliche Führung eine entscheidende Rolle.
- Ein wichtiger sprachlicher Aspekt ist der eurozentrische Blick auf die Dinge. Der Bischof von Luena (Angola), Martin Lasarte Topolansky, drückte es auf der von Papst Franziskus einberufenen Weltsynode 2021-2024 so aus: Man stelle gerne die Probleme der westlichen Kirche so dar, als seien sie die Probleme der Weltkirche. Der Fokus liege somit (beispielsweise) auf der Säkularisierung, womit die Sichtbarkeit der wirklichen weltkirchlichen Herausforderungen beeinträchtigt würde.
- Ein zweiter sprachlicher Aspekt, den Heike Teufel herausstellte, ist eine Mitsprache auf Augenhöhe in der Entwicklungszusammenarbeit, bei der nicht die Helfenden besser zu wissen glauben, was »gut« ist (bzw. was »hilft«).
-
- »Um gute, gleichwürdige Beziehungen auf Augenhöhe mit Menschen in aller Welt eingehen zu können, ist es zuallererst wichtig, mich selbst für mein Gegenüber als Mensch spürbar, fühlbar und berührbar zu machen. Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Was ist eigentlich meine Grundmotivation? Was sind meine Wurzeln? Aus welcher Quelle, aus welcher Fülle schöpfe ich? An welchem Mangel leide ich? Und so hielt ich das auch in meiner Arbeit vor Ort: Auch wenn ich die Menschen besuchte, um ihnen zuallererst zuzuhören, erzählte ich auch doch etwas von mir, machte mich als Mensch spürbar, fühlbar.
Ich halte das für eine Grundbedingung einer anderen, einer gleichwürdigeren Art von Begegnung – in einer dekolonisiert(eren) Entwicklungsarbeit – oder auch weltkirchlichen Arbeit. Nicht der- oder diejenige sein, die von außen, scheinbar aus einer anderen Welt kommt, Geld bringt, Informationen abzieht, BeobachterIn ist oder es sogar noch besser weiß, sondern ein Mensch mit einer Geschichte sein, die vorher exploriert und geklärt sein will, will man sie denn erzählen. Das generiert Sicherheit und Verbindung in einer Beziehung.« - »Wirkliches Zuhören, also nicht bloß mir selber bestätigen dessen, was ich vorher schon wusste, sondern ein Zuhören, bei dem ich meine Meinung revidiere, und wir gemeinsam Neues denken, vielleicht ausprobieren, in die Welt bringen, das hört sich mühsam an. Nicht weil ich den anderen von meiner Idee überzeugen muss, sondern weil ich eine Haltung entwickeln muss, die eigene Vorstellungen, Denkweisen auch emotionale Gewohnheiten durchbricht. Und solche Dialogprozesse brauchen natürlich auch das Abgeben von Macht, welches im Falle der Entwicklungszusammenarbeit ›die Hand auf dem Geld‹ nun mal gibt. Das ist schwere Kost. Denn wo alles auf drei Jahre genau geplant werden muss – möglichst mit Output und Wirkungsanalyse – wo Spendengeld und Steuergelder verteilt werden, wie kann man sich da auf Ergebnisoffenheit und Nicht-Wissen einlassen?«
- »Um gute, gleichwürdige Beziehungen auf Augenhöhe mit Menschen in aller Welt eingehen zu können, ist es zuallererst wichtig, mich selbst für mein Gegenüber als Mensch spürbar, fühlbar und berührbar zu machen. Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Was ist eigentlich meine Grundmotivation? Was sind meine Wurzeln? Aus welcher Quelle, aus welcher Fülle schöpfe ich? An welchem Mangel leide ich? Und so hielt ich das auch in meiner Arbeit vor Ort: Auch wenn ich die Menschen besuchte, um ihnen zuallererst zuzuhören, erzählte ich auch doch etwas von mir, machte mich als Mensch spürbar, fühlbar.
-
Die Wirkmächtigkeit unserer Worte
(entnommen aus einem Predigtimpuls von Pfarrerin Elke Wedler-Krüger für das kommende Kirchenjahr und sehr gut passend zu unserem Schwerpunktthema)
Gott als fürsorglicher Hirte (Ezechiel 34,11-16): Wie Gott sich um seine Schafe sorgt, so sind wir gerufen, für die Schwächsten zu sorgen – für die, die unter den Folgen des Klimawandels am meisten leiden, für die kommenden Generationen, für die stumme Schöpfung.
Das Leben schaffende Wort (Johannes 1,1-18): »Im Anfang war das Wort« – und dieses Wort schafft Leben. Unsere Worte können Leben schaffen oder zerstören. Sprechen wir Worte, die Leben fördern, die zur Bewahrung der Schöpfung ermutigen, die Hoffnung säen?
Die Macht der Worte (Matthäus 16,13-19): Auf Petrus' Worten baute sich die Kirche auf – welche Wirkungsgeschichte! Das zeigt uns: Worte haben Macht. Sie können Bewegungen auslösen, Bewusstsein schaffen, zum Handeln motivieren-
Vier Sprach-Schritte für das neue Jahr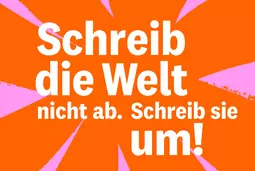
- Sprechen wir von der Schöpfung als Gottes geliebtem Werk.
- Reden wir von Verantwortung.
- Betonen wir Gemeinschaft.
- Verkünden wir Hoffnung.
Wir sollten die Wirkmächtigkeit unserer Worte ernst nehmen.
- Verbinden wir spirituelle Impulse mit konkreten Schritten.
- Sprechen wir von kleinen Anfängen, die Großes bewirken können.
- Ermutigen wir zu nachhaltigen Lebensstilen als Ausdruck des Glaubens.
- Benennen wir Umkehr als Chance, nicht als Strafe.
Worte der Wahrhaftigkeit: Im Geist der Unterscheidung (1. Johannes 2,18-21) müssen wir ehrlich benennen: Die ökologische Krise ist real. Gleichzeitig dürfen wir verkünden: Gott geht mit uns den Weg der Veränderung.

Biblischer Abschluss: Selbstwirksamkeit.
(entnommen einer Reflexion von Pfarrer Dr. Thomas Schaack zum Thema »Sprache und Bibel«)
- Unser Reden soll sagen, was Sache ist: Anderen soll Tatsächliches gesagt werden, nicht »alternative Fakten«, die um des eigenen Vorteils willen manipuliert wurden.
- Unser Reden soll der Gemeinschaft helfen, nicht sie beschädigen: »Du sollst nicht falsch Zeugnis reden« (Ex 20,16). Die Lüge vergeht sich am anderen, gutes Reden aber baut auf.
- Es gibt Visionäre, die der Menschheit tolle Dinge geschenkt haben – häufiger aber gibt es Menschen, die ihre großen Träume nur erfinden, um uns zu verführen: »Ich höre, was die Propheten reden: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen die Propheten aufhören, die Lüge weissagen?« (Jer 23,25f.)
- Unser Reden soll andere nicht mit einem Wortschwall erschlagen und auch kein Reden um des Redens willen sein: »Wo viel Worte sind, da geht’s ohne Sünde nicht ab; wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug.« (Sprüche 10,19)
- Sprache kann zur Waffe werden – Vorsicht also bei ihrem Gebrauch!
- Nicht alles, was Macher machen, führt eine Gesellschaft weiter: Als man früher einmal einen Turm baute, »damit wir uns einen Namen machen« (Genesis 11,3), da verschlug es den Menschen die Sprache und keiner verstand mehr den anderen.
- Idee des Zusammenlebens
Die Themenseite »Gestalten - durch Sprache« begleitet unser Kooperationsprojekt »nachhaltig predigen« durch das Kirchenjahr 2024/25. Das Thema wird wie üblich im Laufe des Kirchenjahres vertieft und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Bistümern und Landeskirchen inhaltlich ausgearbeitet.
| Ihre Redaktionsgruppe | Stand April 2025 |



